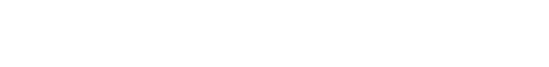Ti1-Pionieraxon
Ti1-Pionieraxon
In diesem Projekt durchleuchtete ich präparierte Embryonen der europäischen Wanderheuschrecke Locusta migratoria mithilfe eines Lasers. Anhand der erfassten Laserscans war es mir möglich, das fluoreszenzmarkierte Nervensystem der Embryonen zu segmentieren. Anschließend rekonstruierte ich die segmentieren Elemente als 3D-Modelle, um sie für weitere Untersuchungen zu verwenden.
Die Embryonen wurden zuvor mit dem starken Umweltgift Methylquecksilberchlorid (CH3Hg+ Cl-) kontaminiert, um das Wachstum des Nervensystems zu manipulieren. Ziel war es, die Auswirkungen dieser Kontamination auf das Nervenwachstum zu untersuchen und es im Verlauf der Studie mit unkontaminierten Proben zu vergleichen.
Die Laserscan-Durchleuchtung ergab detaillierte 360°-Ansichten der Embryonenkörper, wobei das Nervensystem klar und deutlich sichtbar war. Anhand dieser Ansichten war es möglich, die interessanten Bereiche präzise zu identifizieren und aus dem Laserscan heraus zu segmentieren. Insgesamt konnte ich mehr als 24 Embryonen scannen und umfassend analysieren.
Basierend auf den gescanten Daten habe ich die identifizierten Pionieraxone segmentiert und hochauflösende 3D-Modelle aus ihnen erstellt. Mithilfe dieser 3D-Rekonstruktionen war es mir möglich, das Wachstumsverhalten, einschließlich der Wuchsform und -richtung, sowie die Länge der Axone zu messen.
Das Ergebnis dieses umfangreichen Prozesses war die erfolgreiche Rekonstruktion und Vermessung von insgesamt 50 Axonen aus den Scans. Diese Messungen habe ich anschließend mit den Axonen von unkontaminierten Proben verglichen, um die Auswirkungen der Kontamination auf das Wachstum des peripheren Nervensystems zu analysieren. Dies ermöglichte eine detaillierte Analyse der Auswirkungen der Kontamination auf das Nervenwachstum und lieferte wichtige Erkenntnisse für das Verständnis der neurobiologischen Entwicklung unter Umweltstress.
Die Besonderheit dieses Projekts liegt in der beeindruckenden Präzision der Messungen bei einem Maßstab von 150 µm. Das entspricht 0,15 mm. Die Tatsache, dass die Auflösung der Scans ausreichend hoch war, um genaue Messwerte zu erzielen, ist eines der erstaunlichen Ergebnisse dieser Studie.
Noch bemerkenswerter ist jedoch, dass die Auflösung der 3D-Rekonstruktionen ausreichend hoch war, um daraus äußerst detaillierte 3D-Drucke zu generieren. Darüber hinaus wurde die Arbeit erfolgreich in einem wissenschaftlichen Verlag veröffentlicht und erlangte somit einen Platz in einer angesehenen wissenschaftlichen Publikation.